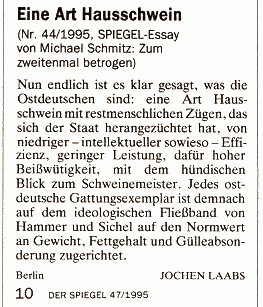|
Aus der Sicht der Ostdeutschen stellt sich die Wiedervereinigung so dar: Lange vor der Wende waren in Westdeutschland schon die Weichen des Staates unverrückbar gestellt und die Reviere aufgeteilt. Auch mit der DDR hatte man sich bei guten Geschäften arrangiert. Das größte Problem der Westdeutschen ist bei und nach der Wiedervereinigung, daß vorhandene Einflußsphären, gewachsene Beziehungen und lieb gewordene Spielregeln nicht angetastet werden. Nachdem das weitestgehend gelungen ist, mögliche ostdeutsche Konkurrenten ausgeschaltet und die Aufteilung der ostdeutschen Immobilien abgeschlossen ist, möchte der Westen am liebsten wieder zur Tagesordnung übergehen. Die mit der Wiedervereinigung drohenden Gefahren sind abgewendet, die damit möglichen Geschäfte sind getätigt. Die Probleme in Ostdeutschland sind weit weg, uninteressant und lästig. Die Sicherung und der Ausbau vorhandener Besitzstände ist angesagt. Schon Adenauer hat dafür die Zielrichtung vorgegeben: 'Keine Experimente !' Für die an politischen Veränderungen (und nicht nur am Konsum) interessierten Ostdeutschen ergibt sich heute eine paradoxe Situation: Wie zu DDR-Zeiten leben sie in einem Staat voller Widersprüche und Reformnotwendigkeiten. Die Einflußmöglichkeiten sind wesentlich größer als in der DDR, aber viel zu gering, um tatsächlich Wirkung zu erzielen. Die Machtelite aber sieht nicht Reformen, sondern die Sicherung des Status quo als ihre erste und vordringlichste Aufgabe an. Damit sind diese Ostdeutschen wieder der gleichen Ohnmacht wie zu DDR-Zeiten ausgesetzt und außerdem noch der unbedarfte Frage: 'Mit der DMark gaben wir Euch unser Bestes, was wollt Ihr denn jetzt noch I?' Resignation ist die Folge. Kein Westdeutscher fragt sich, warum Ingrid Köppe, Wolfgang Uhlmann und Konrad Weiss aus der Politik ausgestiegen sind. Sie hätten sich im Bundestag auch mit Benzin übergießen und anzünden können. Auch das hätte im Westen keine Frage und erst recht keine Wirkung provoziert. Peinliche Affäre. Aber voller Unverständnis und auf der Suche nach Dankbarkeit sehen die Westdeutschen auf ihre seltsamen östlichen Brüder und Schwestern herunter und fragen sich, woher deren Unwohlsein und ihre Politikverdrossenheit kommt. Die in Ost- und Westdeutschland zu beobachtenden Unterschiede sind Realität und Normalität. Niemand konnte nach 40 Jahren unterschiedlichster Vergangenheit etwas anderes erwarten. Es hat auch keinen Zweck, die Differenzen zu leugnen, zu verniedlichen oder unter den Teppich zu kehren. Es hilft nur eines: Wir müssen unsere Verschiedenheit |
kennen und akzeptieren, sie in unserem föderalen Staat als Chance begreifen. Und es muß Zeit vergehen, viel Zeit!. Auch nach 50 Jahren werden noch deutliche Mentalitätsunterschiede vorhanden sein. So selbstverständlich, wie sie heute zwischen Bayern und Norddeutschland bestehen. Außerdem ist jedem einsichtigen Menschen klar, daß die seit dem Mittelalter gewachsenen Besitzunterschiede zwischen Ost und West weder aufzuholen noch aufzuheben sind. Wie soll ein ehemaliger Schlesier zu einem gleichen Kontostand wie ein Bayer kommen? Der Schlesier ist 1945 geflüchtet, hat dann 40 Jahre Zwangsarbeit für den Sozialismus geleistet und hatte 1990 das große Glück, mit 5.000 DM einen weiteren Startversuch zu erhalten. Der Bayer hat weder vom zweiten Weltkrieg noch vom Sozialismus etwas gemerkt, kontinuierlich konnte er sein Eigentum vermehren und vererben.
Heute ist der 4. November. Wer
weiß heute im Osten Deutschlands, wer im Westen, was 1989 an diesem
Tag passiert ist? Es sind nur wenige, die sich daran erinnern. Sicher
die meisten, die wie ich dabei gewesen sind: Am 4. November 1989 fand
auf dem Alexanderplatz in Berlin der neben den Leipziger Montagsdemonstrationen
wichtigste Aufmarsch von DDR-Bürgern gegen ihre Führung statt. Diese Story habe ich am 04. November
1995 per Fax als Leserbrief an den SPIEGEL geschickt.
|
Jürgen Albrecht, 04. November 1995